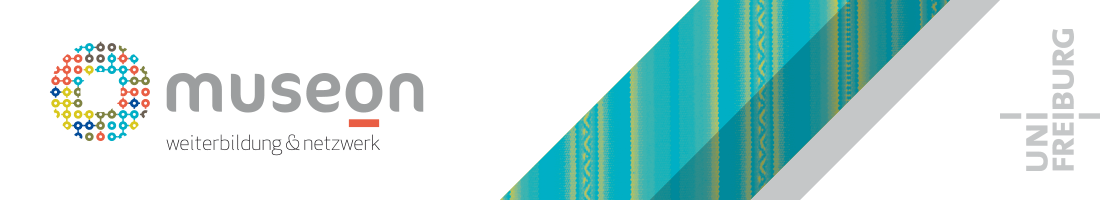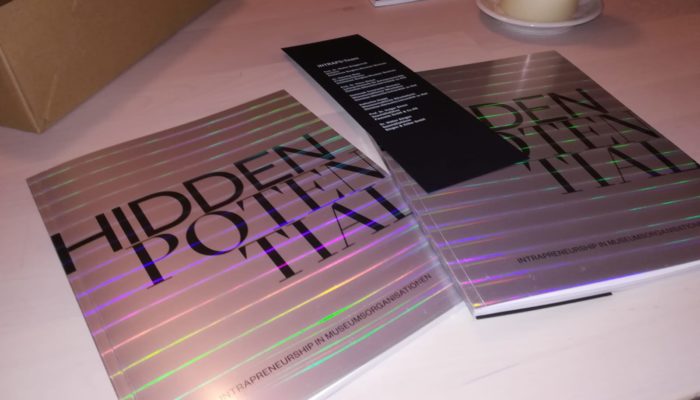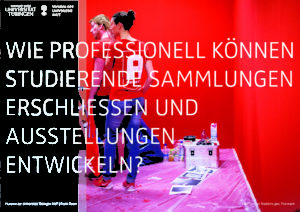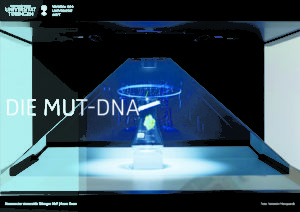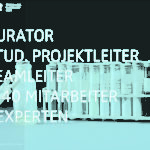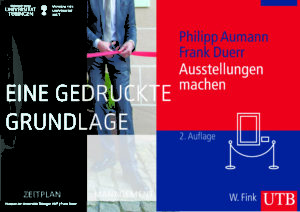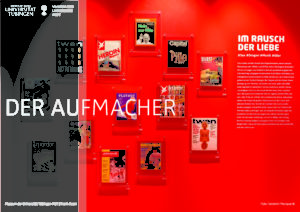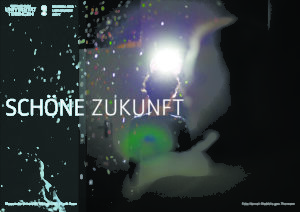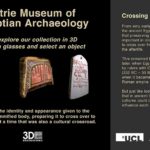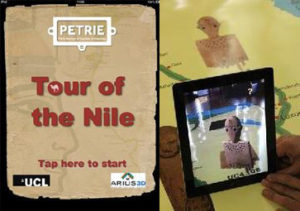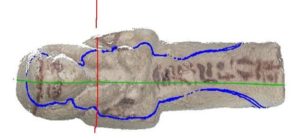Haben Sie qualifizierte Berufserfahrung im Museums- und Kulturbereich und sind schon länger neugierig, wie eine Online-Weiterbildung bei museOn funktioniert?
Möchten Sie sich zwischen Mitte Mai und Mitte Dezember 2019 über einen Zeitraum von 5 Wochen einem museumsbezogenen Thema widmen und können insgesamt dafür etwa 25-30 Stunden aufbringen?
Falls Sie Interesse haben, an einem unserer brandneu entwickelten Blended-Learning-Kurse teilzunehmen, können Sie sich jetzt bei uns als Testperson für den Pilotdurchgang melden! Die Teilnahme ist kostenlos, wichtig ist, dass Sie ausreichend Zeit und Weiterbildungslust mitbringen, um sich in einer kleinen Lerngruppe über 5 Wochen einem speziellen Thema zu widmen. [Read more…] about Jetzt Kurspilot_in bei museOn werden!